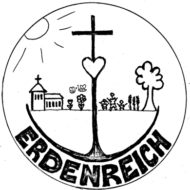Das Thema Mikroplastik ist heute eines, welches immer wieder mal durch die Medien geistert. Als z.B. Umweltverbände darauf aufmerksam machten, daß viele Alltagsprodukte wie Duschbad, Zahnpasta oder Kosmetik absichtlich mit Plastikpartikeln versetzt sind, um einen Schmirgeleffekt ähnlich dem von Schleifsand zu erreichen. Oder wenn Untersuchungen Mikroplastik im Eis der Antarktis oder in den Exkrementen von Menschen und Tieren nachweisen konnten. Eines der vielen Umweltprobleme, die die Menschheit mit ihrer technischen Innovation erschaffen hat.
Doch wie problematisch ist Mikroplastik wirklich? Wo könnten sie uns beeinflussen oder den Menschen und der Umwelt schaden? Was kann man tun, um Mikroplastik gar nicht erst entstehen zu lassen? Viele Fragen und Grund genug, sich im Garten Erdenreich in einer Nachmittagsveranstaltung mit dem Thema zu befassen.
Seminarnachmittag Mikroplastik im Garten Erdenreich
Fachkundige Informationen aus der aktuellen Forschung
Als Referent stand dazu Sven Schirrmeister zur Verfügung, der sich als Chemiker der HTW Dresden mit Mikroplastik – Forschung in Sachsen beschäftigt hat. Für Boden- und Gewässeruntersuchungen ist er auch per Schiff auf der sächsischen Elbe unterwegs gewesen.
Zunächst einmal – Mikroplastik ist nach rund 60 Jahren der Verwendung von Kunststoffen leider überall verbreitet. Die eingangs geschilderten Funde sind Realität – selbst im Mariannengraben, der tiefsten Ozeanrinne der Erde, wurden bereits Proben mit Mikroplastik belastet entnommen.

Als Mikroplastik werden dabei Kunststoffpartikel im Mikrometer – Größenbereich bezeichnet, also weniger als fünf Millimeter in der längsten Ausdehnung. Alles darüber ist Makroplastik, darunter gibt es im Nanometerbereich unter 1000nm sogenanntes Nanoplastik, welches am unteren Ende der Skala schon fast den Einzelmolekülen entspricht. Mikroplastik ist mit blosem Auge kaum wahrnehmbar.

Es geht bei Mikroplastik also nicht um Wale, die an Plastiktüten im Magen verenden oder Bilder von Vogelskeletten, zwischen denen in Magenhöhe Klumpen zusammengeballter Plastesammlungen hängen. Ohne Zweifel ein massives Umweltproblem, aber eben Makroplastik.
Wie entsteht Mikroplastik und wo liegen die Probleme damit?
Wo kommt Mikroplastik her? Natürlich aus dem Umgang des Menschen mit Kunststoffen – Plastiktüten, Plastikflaschen, Styropor – Baustoffe und Verpackungen gelangen, ob komplett oder als Bruchstücke, in die Umwelt, werden vom Wind verweht und vom Wasser davongetragen. Der aktuell größte Verursacher von Mikroplastik ist Reifenabrieb. Mit weitem Abstand folgen etwa Partikel von Plastik – Kleidung wie Fleece – Jacken u.ä.
Unaufhaltsame Verbreitung durch Wasser und Wind

Diese Makroplastikteilchen werden durch mechanische Kräfte wie Wind, Wasser und Reibung z.B. mit Sand immer weiter zerkleinert, bis winzige Fragmente im Mikrometerbereich entstanden sind. Allerdings sind Kunststoffe meist sehr langlebig – deshalb werden sie ja häufig verwendet. Das heißt, die Teilchen werden zwar mechanisch zerkleinert, sind aber chemisch stabil und gelangen deshalb nicht wie natürliche Materialien zurück in die Stoffkreisläufe der Umwelt. Wir werden mit den bereits aus nur rund 60 Jahren geschaffenen Plastikrückständen auf der Erde leben müssen.
Mikroplastik als „Gefahrgut – Transporter“

Was ist das Problem? Wo verursacht Mikroplastik Schäden? Das ist heute noch nicht wirklich klar und gut erforscht. Eigentlich sind die winzigen Partikel ähnlich wie Sand wohl relativ ungefährlich. Doch eine der größten Gefahren liegt möglicherweise darin, daß sie ähnliche Stoffe anziehen – gewissermaßen wie Kristallisationskerne unter passenden Bedingungen Schneeflocken bilden. Und da der Mensch nicht nur Plastikabfälle, sondern auch Medikamentenrückstände oder Umweltgifte in der Landschaft verbreitet, ist es denkbar, daß Mikroplastikkerne Teile dieses Cocktails „sammeln“ und weitertragen. Diese verschiedenen Stoffe könnten miteinander reagieren, was zu tatsächlich noch gefährlicheren Schadstoff – Kombinationen führen kann. Die „Boteneigenschaften“ von einzelnen Mikroplastik – Partikeln macht sich der Mensch sogar schon zunutze. In manchen Medikamenten sind absichtlich Styroporverbindungen enthalten, an denen die arzneilichen Wirkstoffe andocken. Damit gelangen sie gut verteilt an gewünschte Orte im Körper, wo sie ihre Wirkung gegen Krankheiten erzielen. In der natürlichen Umwelt kann es allerdings vorkommen, daß von Mikroplastik gerade Stoffe eingesammelt und konzentriert werden, deren Wirkungen Mensch und Umwelt massiv schaden können. Beispielsweise, indem sie in Trinkwasserleiter gelangen. Oder, indem sie entlang der Nahrungsketten mitwandern und bei Mensch und Tier Krankheiten auslösen. Wasser spielt eine große Rolle beim Transport und der Akkumulation von Mikroplastik in der Natur.
Plastik im Verfall – ein quasi endlos langer Prozeß
Interessant waren einige Bildbeispiele: So fanden Umweltverbände im ausgebaggerten Schlick der Elbvertiefung bei Hamburg eine Plastiktüte von Hustenbonbons. Auf dem Foto sah diese noch ziemlich unbeschädigt aus, wie gerade erst letzte Woche weggeworfen. Doch ein genauer Blick auf die Angaben offenbarte: Die Postleitzahl der Herstelleradresse war vierstellig! Anfang der 90er Jahre wurde das fünfstellige PLZ – System eingeführt. Die Tüte war also mindestens schon 30 Jahre alt.
Zum Mitraten gab es auch eine Plastikflasche – auf den Fotos in verschiedenen Zerfallsstadien, die einen langen Zeitraum simulieren sollten. Die Frage – nach wieviel Jahren würde die Plastikflasche den kleinkörnigen Verfall des letzten Bildes erreicht haben? Schätzungen gingen bis 100 Jahre, doch tatsächlich erweist sich Plastik um ein Vielfaches dauerhafter.

Die Forschung zu Mikroplastik, ihren möglichen Wirkungen und Folgen, steht nach Aussage des Referenten noch ganz am Anfang. Es gibt z.B. noch kein anerkanntes standardisiertes Verfahren, wie man aus einer Bodenprobe exakt alle Mikroplastik – Partikel für die Mengenbestimmung und Untersuchung herauslösen kann. Ebenso ist die Folgenabschätzung noch sehr vage. Große Aufmerksamkeit liegt hier beispielsweise bei der Trinkwassergewinnung, wo langlebige Plastikwerkstoffe in Kombination mit ähnlich strukturierten chemischen Verbindungen ein großes Gefahrenpotential mit sich tragen.
Diskussion ohne happy end
Im Anschluß an den Vortrag gab es Fragen und eine rege Diskussion. Der Referent zeigte sich recht optimistisch, daß vor allem auf EU Ebene Regelungen in Arbeit sind, um das Inverkehrbringen von schädlichen oder gefährlichen Stoffen möglichst vorab zu unterbinden. Hersteller müßten heute viel genauer die Folgen neuer Substanzen abschätzen und deren Ungefährlichkeit darlegen, bevor sie auf den Markt kommen. Diesen Optimismus teilten bei Weitem nicht alle Anwesenden.
Eine Frage war auch, ob es nicht sein könnte, daß sich angesichts der Menge und weiten Verbreitung von Mikroplastik doch irgendwelche Bakteriengruppen auf den Abbau dieser Stoffe spezialisieren könnten und das Problem damit viel früher beseitigen würden als bisher vorausgesagt. Derzeit gibt es keine Bakterien, Pilze oder Mikroben, die Plastik in nennenswertem Umfang abbauen und wieder in natürliche Kreisläufe reintegrieren. Das sei auch kaum zu erwarten, meint der Referent, weil es für diese Organismen kaum einen Vorteil brächte – die Molekülverbindungen seien zu energiearm, um für Bakterien attraktiv zu sein.

Diskutiert wurde natürlich die Frage, wie man die weitere Verbreitung von Mikroplastik eindämmen könnte. Eine richtige Lösung hatte allerdings niemand parat – die Konsumgewohnheiten haben sich an die bequeme Nutzung von Plastik im Alltag angepaßt und es ist kaum vorstellbar, auf diese Vorteile zu verzichten. Vielleicht für Einzelne aus einem hohen Umweltbewußtsein heraus, jedoch nicht als gesamtgesellschaftliche Zielstellung. So war das Ergebnis des Mikroplastik – Seminars etwas zwiespältig: Beruhigend eher dahingehend, daß Mikroplastik allein nach heutigem Kenntnisstand wenig schädliche Auswirkungen auf die natürliche Umwelt hat. Unbefriedigend allerdings, daß es doch potentielle Gefahren z.B. für das Trinkwasser in Verbindung mit anderen „angedockten“ Stoffgruppen gibt und daß die sichtbare Vorstufe „Makroplastik“ nicht nur Landschaften verschandelt, sondern auch andere Lebewesen weiter gefährdet, weil wir Menschen uns keine Alternativen zu Plastikverpackungen oder -Gegenständen mehr denken können.